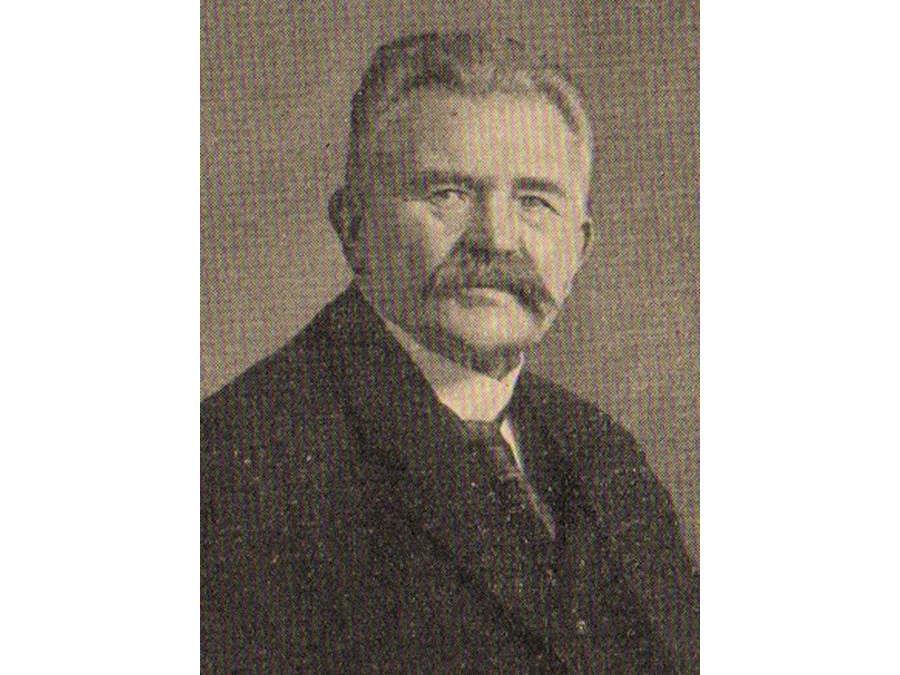Puppe des Jungdeutschen Ordens
Ravensberger Trachtenstoffe, handverarbeitet | 1926-1927
Leihgabe des Historischen Museums Bielefeld
Treudeutsch Allewege! war der rechtsnationale Frontkämpferbund „Jungdeutscher Orden“ – Ortsgruppe Halle i. W. Im Versammlungslokal Brune traf man sich ab 1921. Auch die „Schwesternschaften“ des Ordens hatten sich dem Dienst fürs Vaterland und der Bewahrung deutschen Volkstums verschrieben. Einige „jungdeutsche“ Hallerinnen folgten dem Aufruf des Ordens, für eine deutschlandweite Sammlung puppengroße Trachten ihrer Heimat anzufertigen. So entstand diese Ravensberger Tracht – ein politisches Puppenkind…
Die Exponat-Seite – das Herzstück des Museums!
Jedes Exponat hat eine eigene Seite.
Kehren Sie zurück zu
Ausstellung, Themenwand Not & Politik, ZeitRaum 4 Erster Weltkrieg & Weimarer Republik und finden Sie weitere interessante Ausstellungsstücke.
Details und Hintergründe
Ausstellung, Themenwand Not & Politik, ZeitRaum 4 Erster Weltkrieg & Weimarer Republik
Exponat: Puppe des Jungdeutschen Ordens
„Treudeutsch Allewege!“
Der Jungdeutsche Orden in Halle/Westfalen
Diese kleine Ravensbergerin wurde um 1926/27 in Halle/Westfalen angefertigt. Sie gehört zu einer deutschlandweiten Sammlung von ehemals mehr als 300-400 Trachtenpuppen des Jungdeutschen Ordens. Ziel dieser Sammlung war es, aussterbendes „deutsches Brauchtum“ zu dokumentieren und durch Ausstellungen ins öffentliche Bewusstsein zurück zu holen. Die weitgehend unbekannte Geschichte des Jungdeutschen Ordens, der auch in Halle eine „Gefolgschaft“ gegründet hatte, und später von den Nationalsozialisten verboten wurde, erfahren sie hier…
Frontkämpfer
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg – zur Zeit der Arbeiter- und Soldatenräte – entstanden in Deutschland zahllose Verbindungen ehemaliger Frontkämpfer. Die Männer, die der Krieg geprägt und zum Teil traumatisiert hatte, wurden hier unter Kameraden aufgefangen. Zumeist waren die Bünde politisch klar ausgerichtet, der große Teil nationalistisch, antidemokratisch, etliche gar paramilitärisch und radikal revanchistisch.
Der Jungdeutsche Orden wurde als Frontkämpferbund 1920 von Artur Mahraun in Kassel gegründet. In Halle/Westfalen entstand 1921 eine „Bruderschaft“ des Jungdeutschen Ordens, die sich im Hotel Brune traf. Landrat Roehrig ließ die „Bruderschaftsabende“ überwachen, da die politische Lage angespannt war und ein bewaffneter Umsturz jederzeit befürchtet wurde.[1]
Identitässuche
Nach 1918 sehnten sich viele Deutsche nach einem neuen, vom Krieg unversehrten Gegenstand für ihre Vaterlandsliebe. Nicht selten fanden sie dieses im Rückgriff auf die deutsche Geschichte, die so viel glanzvoller erschien, als die gegenwärtige Not. Besondere Sehnsucht galt der vermeintlich besseren Welt der vorindustriellen Zeit.
In diesem Sinne stellte Artur Mahraun seinen Jungdeutschen Orden in die Traditionslinie des mittelalterlichen Deutschen Ordens. Von den „Bruderschaften“ bis zum „Großmeister“ wurde dessen Wortschatz übernommen, auch das Ordenskreuz war dem historischen Vorbild entliehen.
Der Jungdeutsche Orden hatte eine klar nationalistische Ausrichtung und verfolgte gleichzeitig die Einigung aller Deutschen zu einer „Volksgemeinschaft“ ohne Klassenunterschiede und Standesdünkel.[2] Diese nationale Solidarität traf den Nerv der Zeit!
Dabei war der Jungdeutsche Orden vor 1924/25 ein rechtsextremer Frontkämpferbund, entwickelte sich aber immer mehr in Richtung der politischen Mitte. Zur Reichstagswahl 1930 ging der Orden ein Bündnis mit der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) ein, um als Deutsche Staatspartei gegen die NSDAP antreten zu können.[3]
Der Jungdeutsche Orden in Halle/Westfalen
Die Region Minden-Ravensberg war eine Hochburg des Jungdeutschen Ordens.[4] Schon um 1921 muss sich in der damaligen Kreisstadt Halle eine so genannte „Gefolgschaft“ zusammengefunden haben. Darunter waren angesehene Haller Persönlichkeiten wie der Amtsgerichtsrat Hermann Ostendorf und der junge Holzkaufmann Heinrich Thomas, der später Bürgermeister wurde, sowie die Gattin des Apothekers Scholten und Christian Frederking, der Rektor der Höheren Privatschule.
Die Zahl der Ordensbrüder stieg in Halle rasch an, so dass die „Gefolgschaft“ am 29. April 1923 mit einem großen Fest zur „Bruderschaft“ erhoben werden sollte.
Mehr als 1000 „Jungdeutsche“ feiern auf dem Schützenberg
Mit Sonderzügen des „Haller Willem“ kamen die Jungdeutschen aus der Umgebung, aus Bielefeld und Münster nach Halle. Zwischen der Gaststätte Hollmann und der Bahnlinie nahmen mehr als 1.000 Menschen Aufstellung für den Festmarsch durch die kleine Kreisstadt.
Nachmittags um halb drei war es so weit. Bei kühlen Temperaturen und einsetzendem Regen setzte sich der Zug in Bewegung. Dem Troß voran ritten zwei Ordensritter. Die musikalische Begleitung übernahmen der Gütersloher Jünglingsverein und das Kuhlo-Quartett aus Bielefeld. Über die Allee- und Bahnhofstraße ging es zunächst zum Lindenplatz, von dort auf den Schützenberg, wo bereits eine „stattliche Menschenmenge“[5] wartete. Hier hielt Ernst Tüscher aus Gartnisch die feierliche Eröffnungsrede. Ihr folgten eine Ansprache eines Bielefelder „Komturs“ des Jungdeutschen Ordens und die Vereidigung von Hermann Ostendorf als „Großmeister“ der neuen Haller Bruderschaft. Die Weihe des Banners vollzog Pfarrer Rüter aus Hartum. Abschließend sprachen die Anwesenden den Ordensgruß „Treudeutsch Allewege!“
Deutsche Weihnacht
Schlagzeilen machte die Weihnachtsfeier der des Ordens 1924. Die damals über Halle hinaus erscheinende „Allgemeine Zeitung“ jubelte:
„Eine prächtige, inhaltvolle Weihnachtsfeier veranstaltete der Jungdeutsche Orden, Gefolgschaft Halle. Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Feier war der große Saal bei Hollmann besetzt, und nur durch Einstellung einer fünften Tischreihe konnte man sich helfen. […] Das reiche Programm wickelte sich unter der Leitung des Großmeisters Gerichtsrat Ostendorf ab, den Höhepunkt für die Kinder bildete die Bescherung durch das Christkind und den Nikolaus, doch auch die großen Kinder bereiteten sich eine Verlosung und waren bei dieser fast noch gespannter als die kleinen, ob sie etwas erhielten. […] In launigen Versen überreichte Rektor Frederking den Hauptmitwirkenden Frl. Rietz, Hartmann, Brune und Wagner einen großen Weihnachtsmann und Frau Dr. Scholten einen Lichthalter, und auch den übrigen Mitwirkenden Frl. Baumhöfener [Tochter des Tierarztes] sowie den Brüdern Höfener, Witte, Thomas, Inderwisch und Lohmann wurde der Dank des Ordens ausgesprochen. Es war eine Feier ohne Tanz zu der sich alle Stände bei gemeinsamer Kaffeetafel unter den Farben Schwarz-Weiß-Rot versammelt hatten, getragen von dem Wahlspruch: Treu deutsch allewege!“
Die jungdeutschen Schwesternschaften
„Dem Vaterlande dienen – dazu ist auch die Frau berufen!“[6] – davon waren schon seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon viele deutsche Frauen überzeugt. Nur müsse dies, so die Meinung der Konservativen unter ihnen, auf eine „frauliche Art“ geschehen.
Während einer Verbotszeit des Jungdeutsche Ordens, kurz nach seiner Gründung, hielten die Brüder ihre Treffen privat ab. Dadurch begannen sich die Ehefrauen und Schwestern Zuhause für den Männerbund zu interessieren, dessen politische Ziele sie teilten und unterstützen wollten.[7] Im Januar 1921 rief Charlotte Mahraun, die Gattin des Ordensgründers, daher die erste „Schwesternschaft des Jungdeutschen Ordens“ ins Leben.[8]
Die Schwesternschaft Gütersloh beispielsweise hatte zeitweise bis zu 100 Mitglieder. In der kleinen Kreisstadt Halle werden es zwar entsprechend weniger gewesen sein, diese aber führten ein reges, offenbar auch eigenständiges Vereinsleben.Neben die „blühende“ Bruderschaft des Ordens, trat am 4. Februar 1925 im Brune’schen Saal in Halle eine jungdeutsche Schwesterschaft. Ein Schwerpunkt ihrer „Erziehung der deutschen Frau zum bewußten Dienst fürs Vaterland“[9] war, neben dem karitativen Engagement, die Brauchtums- und Kulturpflege. Die führende Persönlichkeit der Haller Schwesterschaft war die Gattin des Haller Rechtsanwalts Staudacher. Familie Staudacher residierte in der 1912 erbauten Villa an der Graebestraße und genoß in Halle hohes Ansehen. Dementsprechend verlieh Frau Staudachers Engagement der Schwesterschaft besondere Strahlkraft.
Als 1. Mai 1925 die damals sehr beliebte Schriftstellerin Maria Kahle über „Frau und Vaterland“ sprach, wussten auch die Haller Schwestern um ihre Bedeutung und Aufgabe… Maria Kahle „führte in edler, von hoher Begeisterung getragener Sprache aus, wie die deutsche Frau während des Krieges und durch ihr stilles entsagungsvolles Leiden und Mitkämpfen in und nach dem Kriege zur Heldengröße emporgewachsen sei und wie das gemeinsame Leid die deutschen Frauen zusammengeführt und miteinander verbunden habe in dem einen Gedanken: Für das Vaterland, für die gefallenen Söhne, für seine Auferstehung.“ war später in der Allgemeinen Zeitung zu lesen. In Erscheinung trat die Haller „Schwesterschaft“ wenige Wochen später, bei der jungdeutschen Sonnenwendfeier im Sommer 1925.
Die Schwestern tanzen Reigen… – Jungdeutsche Sonnenwendfeier in Halle
Ein großes Fest fand an diesem Sonntagnachmittag auf dem Haller Schützenberg statt. Es stand in der Tradition der Sonnenwendfeiern und –feuer der Jugendbewegung, die viele der Ordensmitglieder geprägt hatte.[10]
Die Wanderabteilungen der jungdeutschen Gefolgschaften aus Werther, Borgholzhausen und Steinhagen waren mit Trommeln, Pfeifen und Bannern nach Halle gezogen, wo um halb vier das Festprogramm begann.[11] Zunächst erläuterte der Haller Großmeister Ostendorf in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Sonnenwendfeier, anschließend wurde gemeinsam gesungen „Hab Sonne im Herzen…“. Die Kapelle spielte einen „flotten Marsch“, Jungbruder Witte trug einige Verse vor und schließlich tanzte die jungdeutsche Schwesternschaft Halle mehrere Reigen. Mit Sing- und Kreisspielen verging der Spätnachmittag und frühe Abend bis zum Einbruch der Dunkelheit. Nun war die Stunde des Sonnenwendfeuers gekommen. Nachdem der Holzstoß mit einem feierlichen „Feuervorspruch“ des Bruders Inderwisch entzündet war, folgte eine weitere Rede und es wurde im Schein der Flammen „Einigkeit und Recht und Freiheit“ angestimmt. Den Abschluss des Abends bildeten weitere Reigen der Schwesternschaft, dieses Mal im Licht des Sonnenwendfeuers.
Etwa ein Jahr später ergab sich für die jungdeutschen Schwestern in Halle ein anderes Feld der Brauchtumspflege: die Teilnahme an der Erstellung einer Sammlung von Trachtenpuppen aus allen Teilen des Deutschen Reiches.
Die Puppensammlung – authentische Trachten en miniature
Im Jahr 1926 erging ein Aufruf an die jungdeutschen Schwesternschaften, die vom Verschwinden bedrohten deutschen Volkstrachten durch Anfertigung einer Miniatur, sprich einer Puppentracht, zu dokumentieren. Ein thüringischer Spielzeugfabrikant und Ordensmitglied stellte die Puppen. Die Kleidung wurde von den Schwesternschaften vor Ort aus verbliebenen Stoffresten von Trachten der jeweiligen Landschaft angefertigt. Großer Wert wurde auf die traditionelle Verarbeitung und die Berücksichtigung aller Details der Ober- und Unterkleidung gelegt. In wissenschaftlichen Fachkreisen fand deren Authentizität schon 1927 Anerkennung… [12]
So ist mit der kleinen Ravensbergerin, die heute, gemeinsam mit etwa 50 weiteren verbliebenen Puppen der Sammlung dem Historischen Museum Bielefeld gehört, ein Stück Haller Geschichte dokumentiert.
Das Ende des Ordens 1933
Durch seine Orientierung zur politischen Mitte ab 1925 verlor der Orden allmählich rechtsnationale Mitglieder, ab 1930 verstärkt und vor allem an die NSDAP. Artur Mahraun wusste Anfang 1933, dass das NS-Regime ihren Konkurrenten und Kontrahenten alsbald verbieten würde. Um die Einziehung des Ordensvermögens zu verhindern, kam er dem Verbot durch die Selbstauflösung zuvor.
Die Trachtenpuppensammlung übernahm Eduard Schoneweg, der Leiter des Städtischen Museums Bielefeld. Mahraun lebte nach 1945 am Kirchplatz in Gütersloh.
Dr. Katja Kosubek
Mit Dank an Martin Wiegand für die online Recherche in der „Allgemeinen Zeitung“, Jahrgänge 1924/1925.
[1] Staatsarchiv Detmold, Akte M1 IP, Nr. 617. Aufruf des Jungdeutschen Ordens an alle „Volksgenossen“ sich zu bewaffnen, um die Verfassung gegen den Umsturz zu sichern. Einberufung eines Treffens im Hotel Brune in Halle 1921. Recherche: Gerhard Renda.
[2] Vgl. Haller Kreisblatt vom 1. Mai 1923, „Bruderschaftserhebung des Jungdeutschen Ordens Halle i.W.“. Stadtarchiv Halle (Westf.).
[3] Bei der Reichspräsidentenwahl 1932 trat die Deutsche Staatspartei für Hindenburg und damit gegen Hitler an.
[4] Landschaftsverband Westfalen-Lippe: Hart & Zart – Die Trachtenpuppen des Jungdeutschen Ordens, Münster 2003; darin: Gerhard Renda: Die Trachtenpuppen des Jungdeutschen Ordens – Vom Schicksal einer Sammlung, S. 70-89, hier S. 76.
[5] Ebd.
[6] Katja Kosubek: Die Alten Kämpferinnen – Weibliches Engagement für die NSDAP (Dissertation in Arbeit), hier Teil I: Motive, sowie das dort zitierte Abel-Biogramm/Nr. 207/Helene Radtke, S. 8.
[7] Zur politischen Partizipation konservativer Frauen vgl. Andrea Süchting-Hänger: Das „Gewissen der Nation“: Nationales Engagement und politisches Handeln konservativer Frauenorganisationen 1900 bis 1937. Dissertation, Düsseldorf 2002, S. 26.
[8] Landschaftsverband Westfalen-Lippe: Hart & Zart – Die Trachtenpuppen des Jungdeutschen Ordens, Münster 2003; darin: Gerhard Renda: Die Trachtenpuppen des Jungdeutschen Ordens – Vom Schicksal einer Sammlung, S. 70-89, hier S. 71ff. mit Verweis auf die Jungdeutsche Frauenzeitung 1926. Die Schwesternschaft Gütersloh beispielsweise hatte im Jahr 1930 mehr als 30 Mitglieder, in der Kleinstadt Halle werden es entsprechend weniger gewesen sein – Zahlen sind bisher nicht bekannt.
[9] Ebd. mit Verweis auf Heinrich Wolf: Der jungdeutsche Orden in seinen mittleren Jahren 1922-1925, München 1972.
[10] Ebenso waren der Volkstanz, der an diesem Tag auf dem Schützenberg von den jungdeutschen Schwestern vorgeführt wurde, und das gemeinsame Singen aus der Wandervogelbewegung entlehnt. Ab 1925 entwickelten sich Volkstanzbewegung und –kreise. Mit Spaß sollte deutsches Volkstum vermittelt und körperliche Ertüchtigung gefördert werden. Vgl. Frigga Tiletschke/Christel Liebold: Aus grauer Städte Mauern … – Bürgerliche Jugendbewegung in Bielefeld 1900-1933, Bielefeld 1995, S. 250.
[11] Haller Kreisblatt vom 30. Juni 1925.
[12] In Minden-Ravensberg entstanden auf Grund der Vielzahl der Ortsgruppen insgesamt 30 kleine Trachten. Während der Jahre 1931-1933 waren die Puppen aus und in Nordwestdeutschland „auf Tournee“. In der zweiwöchigen Schau im Städtischen Museum Bielefeld sollen sie von 10.000 Besuchern bestaunt worden sein. Vgl. Renda, S. 76.